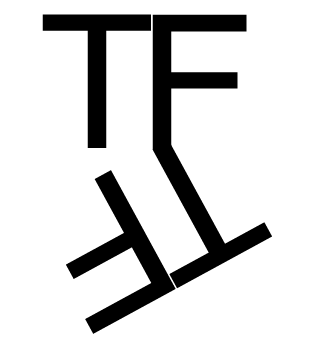Zeit | Langfilm: RUSSIAN ARK
R 2002, Farbe, OmU, 99min
Regie: Aleksandr SokurowBuch: Boris Khaimsky, Anatoli Nikiforov, Svetlana Proskurina, Aleksandr Sokurow
Kamera: Tilman Büttner
Musik: Sergei Yevtushenko
Darsteller: Sergey Dreyden, Mariya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, Mikhail Piotrovsky, u.a.
RUSSIAN ARK folgt einem zeitgenössischen Regisseur (gespielt von Aleksandr Sokurow selbst), der auf magische Weise ins Russland des 18. Jahrhunderts versetzt wird und sich zusammen mit einem französischen Marquis in den Hallen der St. Petersburger Eremitage auf eine Zeitreise durch die russische Geschichte der letzten 300 Jahre begibt.
Aleksandr Sokurow, geboren 1951, ist ein russischer Regisseur und Drehbuchautor (u.a. die „Macht-Tetralogie“: MOLOCH, 1999 (über Hitler), TAURUS, 2001 (über Lenin), SOLONTSE, 2005 (über Hirohito), FAUST, 2011).
Is this only theatre?
Aleksandr Sokurow überträgt in seinem Film RUSSIAN ARK die Zeitstruktur des Theaters in den Film. Was Hitchcock mit COCKTAIL FÜR EINE LEICHE bereits 1948 versucht hat (aber an den technischen Mitteln seiner Zeit gescheitert ist und Hilfsschnitte setzen musste), ist hier das erste Mal in der Filmgeschichte umgesetzt: Ununterbrochen werden 90 Minuten gedreht. An einem Ort. Mit 2000 Statisten und drei Live-Orchestern. Das Filmteam hatte den zeitlichen Rahmen einer Theatervorstellung für den Dreh: nur zwei Stunden. Die Wochen und Monate davor wurden auf einer Probebühne geprobt. Produktions- und Rezeptionszeit verlaufen hier parallel: Was sich auf der Leinwand abzeichnet, ist die Realzeit der Drehaufnahme 2002. Die Schauspieler agieren durchgehend wie auf einer Bühne. Im Hintergrund arbeiten die technischen Gewerke, um reibungslose Übergänge möglich zu machen. Der Schnitt – das seit D. W. Griffith im Vergleich zum Theater wichtigste Mittel des Films – wird eliminiert. Hier werden keine (technischen) Vorgänge verkürzt oder verlängert, sondern der Rhythmus findet im Bild statt. Die Kamera repräsentiert den einen beobachtenden Blick des personifizierten, aber körperlosen Erzählers des Films. Sie lässt keine polyperspektivische Sicht auf das Geschehen zu. Sie wird (zwangsläufig) zum Guckkasten für den Kinozuschauer. Doch der Erzähler/ die erzählende Kamera ist Zuschauer und Akteur zugleich: Er fragt, diskutiert mit, wird aber auch angesprochen, so dass die 4. Wand immer wieder aufbricht und die Inszenierung als eine solche ausgestellt wird.
Hannah Dörr